Text eines Kurzvortrags
~ ~ ~
Die Anfänge: Burg Andechs und die Andechs-Meranier
Andechs war nicht von Anfang an ein Kloster. An der Stelle der späteren Benediktinerabtei befand sich früher eine Burg, die im Jahr 1080 zum ersten Mal urkundlich erwähnt wird. Die Grafen von Dießen verlegten 1132 ihren Hauptsitz dorthin und nannten sich seitdem in Urkunden comes de Andehs, „Grafen von Andechs“. Als dem Grafengeschlecht rund 50 Jahre später von Kaiser Friedrich Barbarossa der Herzogtitel von Meranien, Dalmatien und Kroatien verliehen wurde, begannen sie, sich als „Andechs-Meranier“ zu bezeichnen.
Wichtige Persönlichkeiten aus dem Geschlecht der Andechs-Meranier sind die heilige Elisabeth von Thüringen (1207-1231) und die heilige Hedwig, Königin von Schlesien (1174-1243). 1966/67 wurde eine Kapelle auf der Galerieebene der Klosterkirche für Hedwig eingerichtet, weil ihr Grab im heute polnischen Trebnitz den heimatvertriebenen Schlesiern nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr zugänglich war.
1208 wurde König Philipp von Schwaben ermordet; die Grafen von Andechs wurden der Mitwisserschaft beschuldigt. Reichsacht und Kirchenbann, die gegen sie verhängt wurden, wurden zwar einige Jahre später aufgehoben und die Andechs-Meranier wurden rehabilitiert; dennoch gingen immer mehr Teile ihrer Besitzungen an die Wittelsbacher verloren. Im Jahr 1248 starb der letzte Andechser Graf ohne Kinder. Die Burg Andechs war wohl schon zwei Jahre zuvor zerstört worden. Von ihrer Bausubstanz ist so gut wie nichts mehr erhalten; nur zwei Nebenräume nördlich des heutigen Kirchenschiffs könnten noch auf das Hochmittelalter zurückgehen.
Andechs als Wallfahrtsort
Schon lange vor der Gründung des Klosters war Andechs ein Wallfahrtsort: Die erste historisch nachweisbare Wallfahrt fand im Jahr 1128 statt. Grund dafür ist, dass sich bereits im Hochmittelalter wichtige Reliquien in der Andechser Burgkapelle befanden, darunter viele sogenannte „Herrenreliquien“: Reliquien, die sich auf Christus beziehen, z.B. ein Stück von der Dornenkrone. Ein Teil dieser Reliquien soll der Überlieferung nach sogar auf den Ahnherrn der Andechser Grafen, den 954 verstorbenen Rasso, zurückgehen.
Die Echtheit einiger Reliquien kann mittlerweile zweifelsfrei ausgeschlossen werden, weil sie schlicht nicht alt genug sind, um aus ihrer angeblichen Entstehungszeit zu stammen. Im Mittelalter hielt man auch diese Reliquien für echt und pilgerte zu ihnen, um z.B. für die Heilung von Krankheiten oder die gesunde Rückkehr von einer Reise zu bitten.
Wenn sich das, worum man Christus oder einen Heiligen gebeten hatte, erfüllte, konnte man zum Dank Votivgaben stiften. In der Zeit des Barock handelte es sich dabei in der Regel um Gemälde, von denen einige unter der Orgelempore erhalten sind.
Mit einer Wallfahrt war oft auch ein Ablass verbunden: ein Nachlass der sogenannten „zeitlichen Sündenstrafen“, also der Zeit, die man nach katholischer Vorstellung trotz des Erlasses der Sündenschuld in der Beichte noch im Fegefeuer zu verbringen hätte.
Die mittelalterlichen Reliquien befinden sich heute in der sogenannten Heiligen Kapelle auf der Galerieebene des Klosters. Wenn man an Kunstgegenständen interessiert ist, sind vor allem die oft sehr kunstvoll gearbeiteten Reliquare interessant, die Behältnisse, in denen sich die Reliquien befinden. Reliquare aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die hauptsächlich von Augsburger und Münchner Gold- und Silberschmieden angefertigt wurden, sind nicht in der Heiligen Kapelle, sondern in der daneben gelegenen Reliquienkapelle.
Stiftung des Benediktinerklosters Andechs
Der Reliquienschatz galt nach der Zerstörung der Burg im Jahr 1246 als verschollen. Erst 1388 wurde eine Kiste mit wesentlichen Teilen des Schatzes unter der anscheinend nicht oder nicht stark in Mitleidenschaft gezogenen Burgkapelle wiederentdeckt. Darunter befand sich auch die Hauptreliquie, eine Monstranz mit drei heiligen Hostien, die während der Wandlung angefangen haben sollen zu bluten.
Schon kurze Zeit später scheint es Pläne gegeben zu haben, ein Kloster an Stelle der ehemaligen Burg Andechs zu errichten. Bis sie verwirklicht werden konnten, dauerte es aber noch mehrere Jahrzehnte: 1420 wurde zunächst eine dreischiffige gotische Hallenkirche durch Herzog Ernst von Wittelsbach (1373-1438) gestiftet, auf den auch der Name „Heiliger Berg“ für Andechs zurückgeht. Diese Hallenkirche ist heute noch erhalten, ein Großteil der Ausstattung und Stuckierung stammt allerdings aus der Barockzeit. Im Jahr 1455 stiftete Ernsts Sohn Albrecht III. (1401-1460) dann das Benediktinerkloster, das drei Jahre später zur Abtei erhoben wurde.
Die Frühe Neuzeit: Blütezeiten und Zeiten des Niedergangs
Bis in die 1520er Jahre erlebte das Kloster eine erste Blütezeit; dann nahm im Zuge der sich verbreitenden Reformation und der Kritik am Ablass- und Wallfahrtswesen, aber auch in Folge der Bauernkriege die Zahl der Pilger ab. Erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts verbesserte sich seine Situation wieder – so sehr, dass die Klosterkirche wenige Jahre später nach und nach im Stil der Renaissance umgestaltet werden konnte.
In der Frühen Neuzeit wurde nicht mehr so sehr der Reliquienschatz, sondern vor allem die Gottesmutter Maria in Andechs verehrt. Insbesondere die Holzmadonna am Wallfahrtsaltar (dem unteren Bereich des Hochaltars), die noch aus der Gründungszeit der Abtei stammt, wurde als wundertätiges Gnadenbild verehrt, von dem man sich etwa Krankenheilungen erhoffte.
Die zweite Blüte des Klosters endete jäh, als Bayern ab 1632 zum Schauplatz des Dreißigjährigen Kriegs wurde. Das Tagebuch des Abts Maurus Friesenegger (1640-1655) schildert eindrücklich, in welchem Ausmaß Truppeneinquartierungen, Plünderungen, die Pest und Tierplagen Andechs in dieser Zeit heimsuchten.
Nach dem Krieg erholte sich das Kloster rasch, bis sich 1669 eine weitere Katastrophe ereignete: Ein Blitz schlug in die Kirchturmspitze ein; Kirche und Kloster brannten und wurden dabei schwer beschädigt. Mit dem Wiederaufbau, bei dem der Gebäudekomplex im Wesentlichen seine heutige Gestalt annahm, wurde noch im selben Jahr begonnen. Dabei erhielt unter anderem der Kirchturm – im Kern immer noch ein spätgotischer Viereckbau – seine achteckige Form mit barocker Turmzwiebel.
Neugestaltung des Innenraums im Rokoko-Stil
Das heutige Aussehen der Klosterkirche geht wesentlich auf Arbeiten zurück, die anlässlich des 300-jährigen Jubiläums der Klostergründung im Jahr 1755 unternommen wurden. Insbesondere entstanden neue Stuckaturen und Fresken im leichten, verspielten Stil des Rokoko; auch die Altäre wurden umgestaltet. Während sich das von der Ebene der Galerien aus sichtbare Bildprogramm primär an die Mönche richtet, die dort dem Gottesdienst beiwohnten, bezieht sich die ebenerdig sichtbare ikonographische Ausgestaltung vor allem auf die Wallfahrer, indem sie den Reliquienschatz und Heilswunder in den Mittelpunkt rückt.
Säkularisation
Die Zeit des ersten Benediktinerkonvents in Andechs endete, als das Kloster im Zuge der im Reichsdeputationshauptschlusses 1803 beschlossenen Säkularisierung aufgelöst wurde. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts konnten wieder Mönche aus der neu gegründeten Münchner Benediktinerabtei St. Bonifaz in Andechs einziehen.
~ ~ ~
Einführende Literatur:
Karl Bosl, Odilo Lechner OSB, Wolfgang Schüle und Josef Othmar Zöller (Hrsg.), Andechs. Der Heilige Berg. Von der Frühzeit bis zur Gegenwart, München 1993. [Besonders interessant wegen der enthaltenen Grundrisspläne (S. 193-195) und der Informationsskizzen zum Freskenprogramm (S. 145-146, 148).]
Brigitta Klemenz (Hrsg.), Kloster Andechs (Große Kunstführer 19), 2. Aufl., Regensburg 2005. [Gute, allgemein verständliche Einführung.]

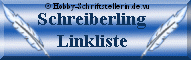
[…] Geschichte der Burg und des Klosters Andechs bis zur Säkularisation 1803 […]