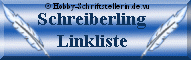Das „Büchnerjahr“ 2013 mit dem 200. Geburtstag des Dichters durfte nicht zu Ende gehen, ohne von mir bei einem Theaterbesuch zelebriert zu werden. Georg Büchners (1813-1837) „Dantons Tod“ (1835) habe ich am 29. Dezember 2013 in einer Bearbeitung von Matthias Günther und Tobias Staab in den Münchner Kammerspielen gesehen. Bevor ich meine Eindrücke von der Inszenierung wiedergebe (Teil 2), möchte ich meine eigene Interpretation des Dramas vorausschicken (Teil 1), das neben Goethes „Faust I“ mein Lieblingsdrama ist. Zitiert wird nach der Szenenaufteilung von „Dantons Tod“ bei „Projekt Gutenberg“.
Wesentlich ist aus meiner Sicht die Darstellung Dantons als eines Menschen, der an den Unmenschlichkeiten der Revolution verzweifelt, die für das Volk keine Besserung seiner Lage mit sich gebracht haben. Er kann nicht mehr an die Willensfreiheit und die Wirksamkeit menschlichen Handelns glauben; stattdessen betrachtet er den Gang der Geschichte als unberechenbar (Fatalismus): „Puppen sind wir, von unbekannten Gewalten am Draht gezogen; nichts, nichts wir selbst!“ (II, 5). Handeln erscheint ihm vom Einzelnen nicht steuerbar; er stürzt in Lethargie und Langeweile, die er durch „Genuss“ nach dem Motto „Wein, Weib und Gesang“ betäubt – was nicht zuletzt zu seiner Gefangennahme und Hinrichtung beiträgt. Bezeichnend der Wortwechsel zwischen Lacroix und Danton in der ersten Szene (I,1), der als epische Vorausdeutung das Ende schon vorwegnimmt: „Wir müssen handeln.“ – „Das wird sich finden.“ – „Es wird sich finden, wenn wir verloren sind.“
Dantons fatalistisches Geschichtsverständnis führt allerdings nicht dazu, dass er die Verantwortung Einzelner für bestimmte Ereignisse ganz negiert. Im Gegenteil fühlt er sich persönlich an den „Septembermorden“ von 1792 schuldig, die er als damaliger Justizminister mit befördert hat. Diese Schuld quält ihn ebenso wie das Bewusstsein, dass die Revolution nichts für die einfache Bevölkerung erreichen konnte.
Robespierre, der ihm wegen seiner Genusssucht sittliche Verfehlungen vorwirft, hält Danton den sprichwörtlichen Spiegel vor und entlarvt dessen Tugendhaftigkeit als Selbstgerechtigkeit: „Ich würde mich schämen, dreißig Jahre lang mit der nämlichen Moralphysiognomie zwischen Himmel und Erde herumzulaufen, bloß um des elenden Vergnügens willen, andre schlechter zu finden als mich. – Ist denn nichts in dir, was dir nicht manchmal ganz leise, heimlich sagte: du lügst, du lügst!?“ (I,6) Tatsächlich stürzt er den „Unbestechlichen“ damit in Selbstzweifel, doch aus dieser Handlungslosigkeit entreißt ihn sein Scharfmacher St. Just sogleich wieder, um den Tod der Dantonisten zu beschließen.
Danton ist seines Lebens überdrüssig; er sehnt sich nach Selbstauslöschung und damit auch der Auslöschung seiner Seelenqual, möchte endlich Ruhe im Nichts finden. Doch auch der Nihilismus bietet ihm letztlich keine Zuflucht: „Der verfluchte Satz: Etwas kann nicht zu nichts werden! Und ich bin etwas, das ist der Jammer!“ (III,7). Sogar die Selbstauslöschung erscheint also als Ding der Unmöglichkeit. Danton will nicht mehr leben, doch auch im Tod ist für ihn keine Hoffnung auf Erlösung – religiöse ohnehin nicht, aber eben auch keine philosophische.
Oder vielleicht doch? Dantons letzte Worte, bevor er von der Conciergerie auf den Revolutionsplatz zur Hinrichtung geführt werden, lauten: „Die Welt ist das Chaos. Das Nichts ist der zu gebärende Weltgott.“ (IV,5) Die vage Hoffnung, dass das ersehnte Nichts irgendwann entstehen könnte (wie die Welt nach Hesiods Theogonie (Θεογονία), auf die Büchner hier wohl anspielt, oder Gen 1,1 irgendwann aus dem Chaos entstanden ist, möchte man hinzufügen), hat er also nicht ganz aufgegeben. Aber nach Hesiods „Werke und Tage“ (Ἔργα καὶ Ἡμέραι) blieb ja auch in der Büchse der Pandora am Ende nur die trügerische(!) Hoffnung zurück…
Dantons Philosophie ist kein geschlossenes System; sie wandelt sich im Verlauf des Stücks.
Dass sich Danton am Ende vor dem Revolutionstribunal doch gegen seine Ankläger verteidigt (III,9 und 10), ist wohl mehr dem Wunsch geschuldet, es den radikalen Jakobinern um Robespierre nicht gar zu leicht zu machen und die eigene Haut nicht gar so billig zu verkaufen, als ein ernsthafter Versuch, sie zu retten. Es gelingt ohnehin nicht; die Volksmasse ist zu wankelmütig und unberechenbar, als dass sie sich von Dantons Argumenten dauerhaft gewinnen ließe. Aber ist auch hier nicht eine leise Hoffnung? Die Hoffnung nämlich, dass der Tod der gemäßigten Jakobiner um Danton bereits den Sturz Robespierres vorwegnimmt – und damit letztlich doch das Ende des Terreur und seines sinnlosen Mordens bringt. „Ihr tötet uns an dem Tage, wo ihr den Verstand verloren habt; ihr werdet sie an dem töten, wo ihr ihn wiederbekommt“ (IV,7) – so spricht allerdings nicht Danton, sondern Lacroix, der ja weiter an der Bedeutsamkeit menschlichen Handelns festhält. Gut möglich, dass Danton seine flammende Verteidigungsrede nur aus Verbundenheit mit seinen Freunden hält, die mit ihm todgeweiht sind, weil er nicht handelte, als vielleicht noch Zeit gewesen wäre. Lacroix’ Worte sind und bleiben aber eine Vorausdeutung – keine intrafiktionale, sondern eine auf den weiteren Verlauf der Geschichte. Sie lassen zumindest diese Überlegung zu: Wenn Dantons philosophische Reflexionen über das Nichts und die Geschichte Büchners persönliche Überzeugungen wiedergeben (was man wohl annehmen darf, da Büchner entsprechende Überlegungen in Briefen äußert), dann ist Dantons/Büchners Geschichtsfatalismus vielleicht ebenso brüchig wie Dantons/Büchners Nihilismus. Ein geradezu postmodernes Denken, dieses Vielleicht-doch, das das Vorhandensein absolut gesetzter Überzeugungen/Ideologien negiert, ohne letztlich eine Lösung anbieten zu können. Ja, auch Büchners eigenes Handeln als Revolutionär in der Vormärzzeit, insbesondere seine Flugschrift „Der Hessische Landbote“ (1834), blieb letztlich ohne die erhoffte Wirkung. Aber … vielleicht doch?
Kurzum: Für mich sind zum einen die philosophische Dimension des Dramas (Geschichtsfatalismus und Nihilismus wie auch das Ungenügen an ihnen) und zum anderen die (entsprechend der Quellen, die Büchner zur Verfügung standen) möglichst realistische Darstellung der Revolutionszeit die beiden wesentlichen Interpretationszugänge zum Drama. Zu letzterem Punkt, auf den ich hier nur oberflächlich eingegangen bin, zählen sowohl die Darstellung der prekären Situation des Volkes und der Eigendynamik von Volksmassen als auch die zahlreichen wörtlich eingewobenen Quellenpassagen insbesondere in Bezug auf politische Äußerungen. Die wörtlichen Zitate sind, ebenso wie die vielen klassizistischen Anspielungen der Revolutionäre auf die Antike, für die intertextuelle Mehrschichtigkeit des Dramas wichtig; ich will aber nicht verhehlen, dass mich die philosophische Seite mehr interessiert, ich ihr deshalb auch mehr Raum gegeben habe.